April 18, 2024
Im März habe ich hier über meine Stille-Erfahrung geschrieben. Seitdem habe ich weiter über Entschleunigung nachgedacht und darüber, inwieweit KI-Technologien in unsere Produktivität eingreifen – und wofür überhaupt. Manchmal nagt es an mir und ich frage mich, wo wir mit dieser gesteigerten Effizienz denn eigentlich hinwollen. Brauchen wir mehr Geister als unseren eigenen? Und was hat das Ganze mit FOMO zu tun? Ein Gedankenspaziergang.
Über Hyper-Wachsamkeit
In einem Artikel der National Geographic vom 9. April werden die Folgen von “urgency culture”, also einer Dringlichkeitskultur in unserer beschleunigten Gesellschaft beschrieben. Ein Begriff, der in diesem Kontext fällt, ist „hypervigilance“. Das Wort trifft es äußerst gut – vigilia bezeichnete im römischen Reich die Nachtwache, einen Wachposten, daran angelehnt auch Wachsamkeit und in der Folge Schlaflosigkeit. Hypervigilance übersetze ich einfach mal mit Hyper-Wachsamkeit oder Überaufmerksamkeit – ein stressauslösendes Gefühl, das wir sicher alle zu gut kennen, auf unseren schnellen Wegen von A nach B, beim nervösen Blick aufs Smartphone, bei aufploppenden E-Mail-Benachrichtigungen, zwischen Deadlines und Terminen festhängend.
Eile mit Weile war gestern
In der National Geographic wird eine Studie zitiert, die besagt, dass fast ein Viertel der Erwachsenen in den USA nach der Corona-Pandemie ein hohes Maß an Stress empfinden, jüngere Menschen seien zudem ängstlicher geworden. Zur Angst gehört u.a. die Fear of Missing Out – das Gefühl, etwas zu verpassen oder nicht auf dem Laufenden sein zu können, auch wenn man jeden Tag erneut im Hamsterrad mitläuft. Inmitten der Informationsflut, der Orts- und Zeitunabhängigkeit des Internets ist dieses Gefühl allgegenwärtig und fast unvermeidlich. Solcherlei Ängste wiederum würden aber das Getrieben-Sein und das Gefühl von Hektik verstärken und einen Teufelskreis auslösen. Diese teuflische Kombination aus Reizüberflutung, Eile und Ängsten überstimuliert das Nervensystem und führt dazu, dass wir emotional abstumpfen.
Die ständige Ungenügsamkeit
Wir haben gar keine Zeit mehr, uns wahrhaftig und angemessen zu freuen oder auch zu trauern oder uns tatsächlich eingehend mit unserer Gefühlswelt auseinanderzusetzen, Erlebtes einzuordnen und zu verarbeiten. Ein Ereignis jagt das nächste und schon muss man wieder reagieren. Die Folge sind Mangel-Erleben, Ungenügsamkeit und Entfremdung. Über diese Phänomene hat der Soziologe Hartmut Rosa übrigens schon 2013 ein Buch mit dem Titel „Beschleunigung und Entfremdung“ geschrieben (der lesenswerte Spiegel-Artikel dazu fasst die Kernthesen zusammen).
Wir haben auch keine Zeit mehr, uns Dingen bewusst zu widmen und ihnen unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken, sei es in Partnerschaften, Freundschaften, unter Kolleg*innen, sei es die Erledigung von Aufgaben, das Schreiben von Texten, das genussvolle Lesen… Kein noch so ruhiger, störungsfreier Moment hält lange genug, denn wir sind alle digital miteinander verbunden, nur einen Swipe voneinander entfernt und die Verlockung, nicht mit mir allein zu sein, sondern mir die virtuelle Welt ins Wohnzimmer (oder schon morgens vor dem Aufstehen oder direkt vor dem Schlafengehen ins Bett) einzuladen, ist groß.
Künstliche Intelligenz vs. Kulturtechniken
Die Verlockung wird noch größer und folgenreicher in Zeiten von Künstlicher Intelligenz. Warum auch sollte man seine ganze Aufmerksamkeit einem Text, einer wissenschaftlichen Publikation, einer Aufgabe widmen und mit eingeschränkter Kapazität von nur einem denkenden Gehirn arbeiten? Ich weiß, die Frage ist ziemlich polemisch und angesichts des KI-Hypes fast schon unangemessen. Ich benutze auch gern ChatGPT, ChatPDF, Scispace und Co. für meine Arbeit – alles geht so viel schneller und ich bin nicht länger begrenzt und auf mich selbst und meine Gedanken zurückgeworfen. Manchmal frage ich mich aber, warum das Ganze? Wir haben es mit disruptiven Technologien zu tun, die die Art, wie wir bisher gearbeitet und gedacht, gelesen, geschrieben und (im Uni-Kontext) geprüft haben, dauerhaft verändern werden. Ich bin nicht gegen technische Innovation, aber ich bin mir nicht sicher, ob es hilfreich ist, inmitten von Informationsflut, Fake News und wachsender Skepsis gegenüber Medien und Wissenschaft die grundlegenden Kulturtechniken des Lesens und Schreibens ad acta zu legen.
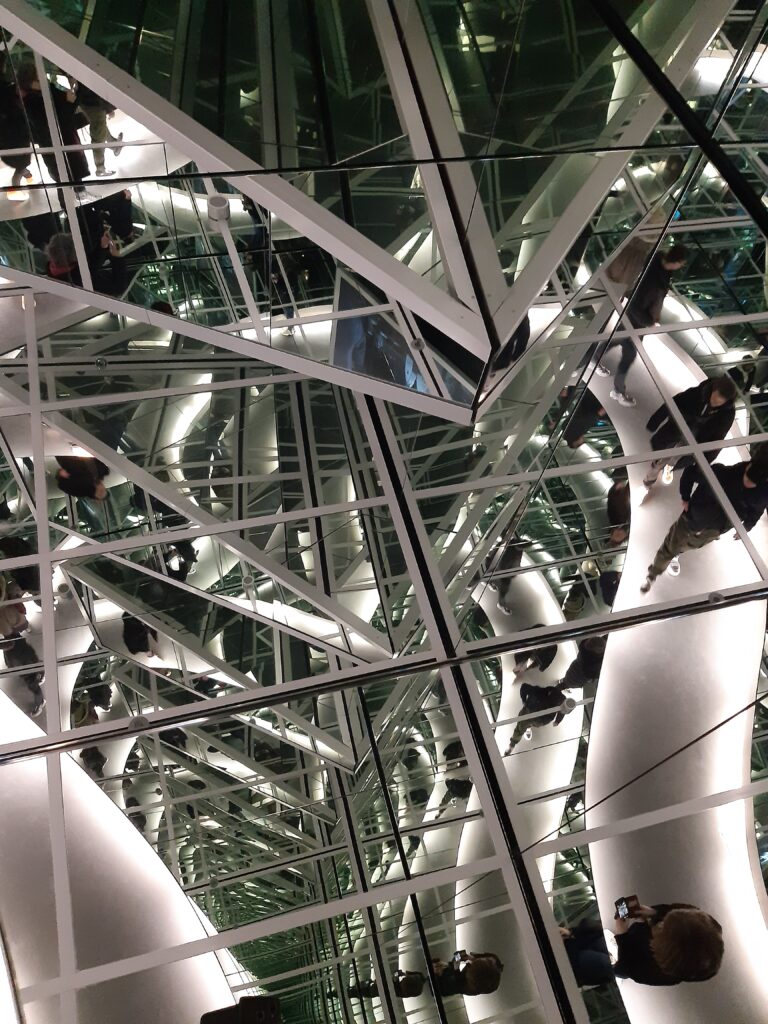
ChatPDF und andere KI-Programme lesen für uns relevante Informationen aus PDF-Dateien aus und fassen sie in übersichtlichen Bulletpoints für uns zusammen. Scispace kümmert sich um meine Literaturrecherche und serviert mir die für meine Forschungsfrage relevanten Studien auf dem Silbertablett. ChatGPT hilft mir beim Erstellen der Gliederung, beim Formulieren, Redigieren, Zitieren, … Die Frage, inwieweit all diese KI-gesteuerten Prozesse stets akkurat und korrekt ablaufen bzw. welche Zukunftskompetenzen oder Future Skills es in der Arbeit mit KI braucht und wie sie vermittelt werden, ist damit noch nicht einmal beantwortet.
Des Pudels Kern

Fakt ist aber, die Denk- und Arbeitsprozesse werden damit auch in der Wissenschaft erheblich beschleunigt. Auch hier haben wir keine Zeit mehr und fühlen uns getrieben. Wie Hartmut Rosa feststellt, führt technischen Beschleunigung (und dazu gehört seit anderthalb Jahren auch die Arbeit mit text- und bildgenerierenden KI-Modellen) paradoxerweise nicht dazu, dass wir ein Gefühl von mehr Zeit entwickeln, geschweige denn mehr Zeit zur Verfügung haben. Das führt mich zu der Frage, was eigentlich der Kern der Wissenschaft ist? Geht es darum, schneller und produktiver zu sein, in kürzerer Zeit mehr zu publizieren, mehr Sichtbarkeit zu generieren, auf mehr Konferenzen zu sprechen, mehr Gelder einzuwerben (und die Realität zeigt: ja, so sieht es oft aus und die Beschleunigung macht auch vor der Alma Mater nicht halt)? Oder ging es ursprünglich nicht mal darum, sich eingehend mit Ideen, Konzepten, Gedanken, Hypothesen, Fragen, Ergebnissen auseinander-zu-setzen (!), abzuwägen, zu vergleichen, eine Meinung zu bilden, argumentativ einen eigenen Standpunkt zu beziehen, sich aufeinander zu beziehen?
Fernseh-Aufzeichnungen aus den 1960er und 70er Jahren auf youtube zeigen sehr eindrücklich, wie unaufgeregt und profund, wie fruchtbar, wortgewaltig und störungsfrei damals gedacht, gesprochen und diskutiert wurde. Mir fällt da das Gespräch zwischen Günther Grass und Thomas Brasch von 1977 ein oder zwischen Günter Gaus und Hannah Arendt 1964. Überhaupt wurden mir die Interviews von Günter Gaus mit deutschen Politiker*innen von einem Freund empfohlen, der sich letzten Sommer lange mit mir über die „verlorene Artikulationsfähigkeit“ in der heutigen Zeit unterhielt. Und noch vor dem Verlust der Artikulationsfähigkeit steht das eigene Durch-Denken.
Solche Prozesse brauchen Zeit und einen eigenen Geist, nicht die ghosts großer Large Language Models. Das Wissen muss erst einmal „einsinken“, ich muss mich hinsetzen, es zusammen- und auseinandersetzen, mich in etwas hineinversetzen, es mir zu eigen machen, mit meinem Weltwissen verknüpfen – es, wie meine Coachin einmal schön sagte, „erst einmal spazieren tragen“. Das Spazierentragen braucht Zeit und Ruhe und dedication, ein Sich-Widmen. Blitzgedanken, Aha- und Heureka-Momente kommen nicht, während ich auf Instagram scrolle. Und sie kommen nicht unbedingt, wenn ich alle Aufgaben an KI-Systeme delegiere und am Ende scheinbar perfekte Antworten geliefert bekomme, die mit mir aber gar nichts zu tun haben. Eigene Einfälle kommen bei repetitiven Alltagstätigkeiten, vielleicht beim Auto- oder Radfahren, beim Kochen, beim Duschen, beim Einschlafen oder Aufwachen (ohne Smartphone). Sie kommen dann, wenn wir nicht vom Wesentlichen abgelenkt oder vom Unwesentlichen getrieben werden. Sie kommen, wenn wir in der Gewissheit von Genügsamkeit, Zeit, Aufgehoben-Sein und Vertrauen ruhen.
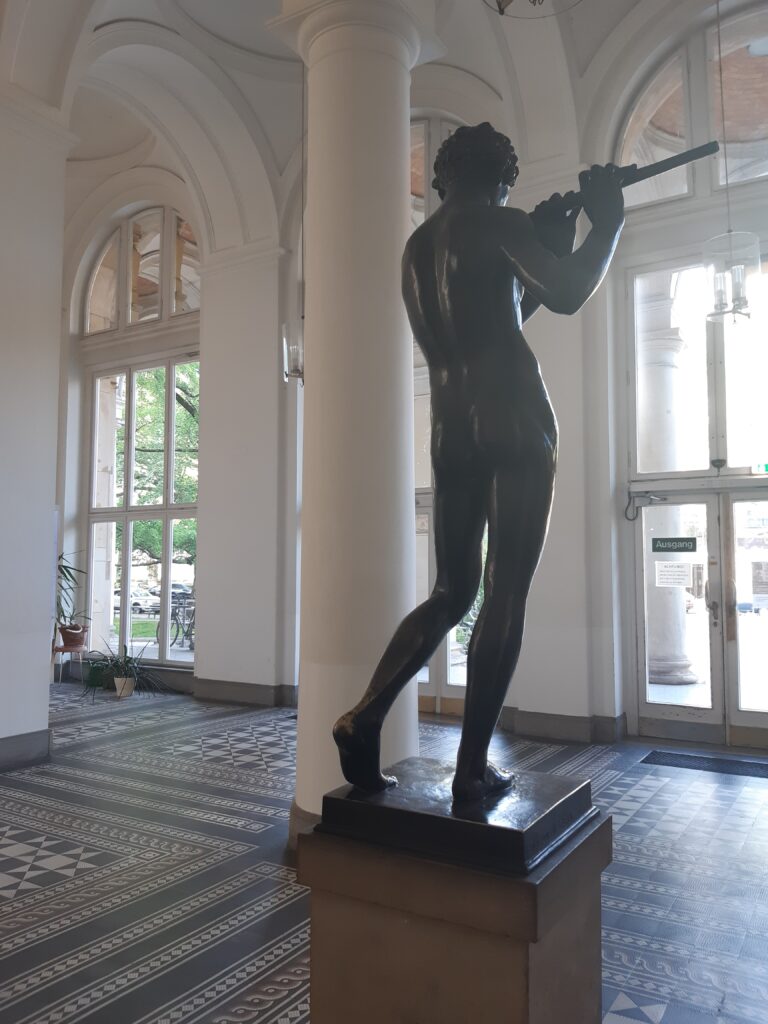
Das machen wir in der Regel nicht mehr, denn es erfordert klare Regeln, Grenzen und Bewusstheit über die Mechanismen, die um uns und in uns wirken. Unsere Körper kommen bei all den auf uns einströmenden vielen, bunten, vielversprechenden Möglichkeiten der modernen Welt nicht hinterher, denn anders als die große, nicht real greifbare Internet-Bubble ist unser Körper durchaus räumlich und zeitlich gebunden – wir vermögen es nicht, gleichzeitig „auf mehreren Hochzeiten zu tanzen“, und auch im übertragenen Sinne zeigen Studien, dass unser Gehirn nicht gut darin ist, zu multitasken (schöner Anglizismus). Vielmehr lösen immer neue Ereignisse einen körperlichen Ausnahmezustand aus. Das Nervensystem ist in der Hypervigilanz, ist überaufmerksam, alarmiert und tariert angesichts der Bedrohung zwischen Fight oder Flight. Welche körperlichen Prozesse dabei ablaufen, erklärt dieser kurze Clip von Terra X.
Wenn Fight und Flight, Angriff oder Flucht nicht möglich sind, bleibt nur noch eins: Freeze. Stehenbleiben. Bevor wir aber aus Schockstarre und purer Überwältigung stehenbleiben, sollten wir lernen, das außerhalb bedrohlicher Situationen zu tun. Stehenbleiben, bevor es zu spät ist, anhalten, abschalten (wie Peter Lustig es immer am Ende von Löwenzahn sagte), atmen, im eigenen Körper ankommen. Die Über-Aufmerksamkeit bewusst ablegen. Und das am besten auch nicht alleine, sondern im zwischenmenschlichen (und nicht KI-generierten) Gespräch, bestenfalls wohlartikuliert und nicht virtuell, und mit der Unterstützung von Menschen, die unser Leben bereichern. Wir sind alle am selben Punkt. Und wir können zusammen einen Unterschied machen. Aber jetzt erstmal:


Dozentin und Schreibtrainerin in Berlin
Wissenschaftliches und kreatives Schreiben, (Hochschul-)Didaktik
Deutsch als Fremdsprache
